Als Friedrich Schiller diesen prägnanten Satz 1795 in seinen
"Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" formulierte,
meinte er ein Ideal des geistig-künstlerischen Ausdrucks
ohne jegliche gesellschaftliche Zwänge, von dem seine Zeit leider
weit entfernt sei.
Nun hat sich seitdem die...
prečítať celé
Als Friedrich Schiller diesen prägnanten Satz 1795 in seinen
"Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" formulierte,
meinte er ein Ideal des geistig-künstlerischen Ausdrucks
ohne jegliche gesellschaftliche Zwänge, von dem seine Zeit leider
weit entfernt sei.
Nun hat sich seitdem die Kunst sehr verändert und entwickelt,
gerade wenn man deren Eroberung des öffentlichen Raumes
als Ort vielfältigen dynamischen Gestaltens, Experimentierens
und temporären Intervenierens in den Blick nimmt. Hier
entstehen heutigentags weniger angepasste, mit der öffentlichen
Meinung konforme Denkmale für die Ewigkeit, sondern viel
mehr freie künstlerische "Bespielungen" des öffentlichen Raumes,
die gänzlich eigenständig, kritisch und stark realitätsbezogen
sind sowie zur Interaktion animieren. Diese Entwicklung
war nicht etwa leise schleichend, sondern ging - übrigens auch
in Jena - einher mit teils heftigen öffentlichen Diskussionen.
In der Lichtstadt erhielt die Kunst im öffentlichen Raum
vor allem nach der politischen Wende von 1989 in Verbindung
mit der intensiv einsetzenden Bautätigkeit und der Etablierung
Jenas als Modellstadt für Stadtsanierung eine neue Wertigkeit.
Ein zwischenzeitlicher Höhepunkt, auch hinsichtlich der in der
Öffentlichkeit durchaus kontrovers geführten Debatten, wurde
1996 mit der durch Lothar Späth initiierten Platzierung von
Frank Stellas Skulpturen der "Hudson River Valley Series" auf
dem Ernst-Abbe-
Platz erreicht. Hier, wie auch im Fall des interaktiven "Audiowalks Jena-Cospeda" der kanadischen
Künstlerin Janet Cardiff, vermag Jena an seinen Ruf als Kunststadt
am Anfang des letzten Jahrhunderts würdig anzuknüpfen.
Der Jenaer Bestand an Kunst im öffentlichen Raum ist
quantitativ betrachtet für eine Großstadt eher unterdurchschnittlich,
jedoch sind Genre und Stile vielfältig und facettenreich. Zu
den Kunstwerken gehören plastische Denkmale, Skulpturen, Installationen,
baugebundene Kunst, Brunnenplastiken, Licht- und
Audiokunst. Der Bogen spannt sich von traditionellen porträtfigürlichen
Skulpturen mit Denkmalcharakter wie dem Hanfried
aus dem 19. Jahrhundert über auftragskonforme zeitgemäße
Lösungen wie die baugebundene Kunst in Neulobeda
aus
DDR-Zeiten bis hin zu immer wieder polarisierenden unkonventionellen
Gegenwartskunstwerken wie den "drei Moiren"
im Paradies oder den Metazeichen für Jena am Holzmarkt.
Der überwiegende
Teil dieser Objekte wird städtisch verwaltet.
Ihre größte Dichte findet sich in den Stadtteilen Lobeda-Ost
und Lobeda-West. Die Objekte dort stammen vornehmlich aus
der Entstehungszeit der Plattenbausiedlung, den 70er und 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts, als im Rahmen der Errichtung der
DDR-Neubausiedlung so genannte baugebundene Kunst systematisch
beauftragt und aufgestellt wurde.
Später wurden im Rahmen einer Ausschreibung zur Fassadengestaltung
in Lobeda der Neonschriftzug "Ich sehe was,
was du nicht siehst" von Stephan Jung als Blickfang am Giebel
des Hochhauses Kastanienstraße 2 installiert (1998) und als
EXPO-Projekt ein überdimensionierter Stuhl aus Glas und
Edelstahl in Lobeda West (2000) aufgestellt.
Der 1992 etablierte städtische Botho-Graef-Kunstpreis für
zeitgenössische Kunst brachte zwischen 2000 und 2015 bisher
vier Wettbewerbsentwürfe in den öffentlichen Raum: die schon
genannte Lichtinstallation "Zwei Metazeichen für Jena" von
Mischa Kuball auf dem Holzmarkt, die zweiteilige Arbeit "Intellektuelle
Zweisamkeit" mit LED-Laufschrift und Messing-Bodenplaketten
von Maria Vill und David Mannstein auf dem
Markt und die begehbare Gartenbauskulptur "Folly" von Anika
Gründer im Garten der Villa Rosenthal sowie den ebenfalls
bereits erwähnten "Audiowalk Jena-Cospeda" von Janet Cardiff.
Eingebettet in städtebauliche Sanierungsmaßnahmen.
Skryť popis
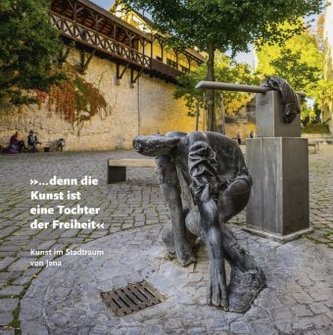




Recenzie